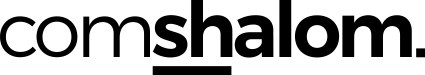Das Geheimnis des Bündnisses
Das Christentum besitzt unter seinen vielen ursprünglichen Merkmalen das einer so innigen Teilhabe des Menschen an der Gottheit, dass es eine Verschmelzung ohne Verwirrung schafft. Die Eucharistie zielt in erster Linie darauf ab, wie aus einer Reihe von Zeugnissen hervorgeht, von denen wir eine illustrative Auswahl geben. Der heilige Thomas schreibt: „Die eigentliche Wirkung der Eucharistie ist die Verwandlung des Menschen in Gott“, also seine Vergöttlichung. Es wäre schwierig für den Menschen, ein höheres Ziel anzustreben. Auf der gleichen Spur das Vatikanische Konzil zitiert einen Satz des heiligen Leo des Großen: „Die Teilhabe am Leib und Blut Christi macht uns nur zu dem, was wir nehmen“. (Lumen Gentium, 26). Und schließlich überlassen wir das Wort einer Mystikerin, der heiligen Theresia vom Kinde Jesu: „‘Mein Himmel‘ ist in der Partikel (Hostie) verborgen, in dem Jesus, mein Bräutigam, aus Liebe verhüllt ist (…). Was für ein göttlicher Moment, wenn du, o Geliebter, in deiner Zärtlichkeit kommst, um mich in dich zu verwandeln! Diese Vereinigung von Liebe und unaussprechlichem Rausch, ‚siehe, der Himmel, der mein ist!‘“
Evangelium: Ein geheimnisvoll reales Bündnis
Die lange Rede, die auf die Brotvermehrung folgte, hatte die Schlüsselbegriffe des Geheimnisses Jesu und seiner Beziehung zu den Menschen hervorgehoben. Wichtige Themen wurden veranschaulicht: der Glaube, die Eucharistie, die Inkarnation, das Leben.
An dieser Stelle wird unser Abschnitt eingefügt, der in zwei Momente unterteilt ist: die Abtrünnigkeit der Jünger (V. 60-66) und das Bekenntnis des Petrus (V. 67-69). Der Teil, der nun beginnt, unterscheidet sich zwar ein wenig vom vorhergehenden, bleibt aber eng mit ihm verbunden, da er in einer engen Beziehung von Ursache und Wirkung steht. Es ist der Übergang vom theoretischen zum praktischen Teil, vom Moment des Zuhörens zu dem der Akzeptanz, vom Folgen durch Sympathie und Verständnis zu dem der bedingungslosen Anhänglichkeit an eine Person. Das Wort Jesu war erhaben (Er identifizierte sich mit der Gabe Gottes, dem wahren Brot des Himmels) und gleichzeitig drastisch, weil es nicht leicht zu verstehen war (diese Speise war sein Leib, den man essen und sein Blut, das man trinken sollte). Der heutige Abschnitt beginnt mit einem Ausruf und einer Frage, die die Verwirrung seiner Jünger zeigen: „Dieses Wort ist schwer! Wer kann es hören?“.
An ihrer Frage ist etwas Wahres dran. Man kann die Orientierungslosigkeit des Menschen vor dem Erscheinen des Göttlichen lesen. Die Jünger spüren, dass die Abstand groß ist. Sie maßen sich an, sie zu überwinden, indem sie eine gemeinsame, gewohnheitsmäßige Haltung einnehmen: den Besitz der Botschaft des Evangeliums mit rationalen Mitteln. Sie erkennen den Fehler nicht, sie erkennen nicht die Grenze der Vernunft. Die Vernunft, die bei so vielen Gelegenheiten ein unverzichtbares Werkzeug ist, offenbart hier ihre ganze Unzulänglichkeit; mit reiner Intelligenz hat man nämlich keinen Zugang zur göttlichen Welt. Pascal verstand dies gut, als er von den „Gründen des Herzens“ sprach, die der Verstand nicht besitzt.
Die Aussagen Jesu klingen für Ohren, die an rein menschliche Worte gewöhnt sind, überraschend, ja „skandalös“. Sie mit dem Verstand und dem Herzen anzunehmen bedeutet, sich auf den noch beunruhigenderen Skandal des Kreuzes vorzubereiten. Dort werden die Opferung eines Körpers und das Vergießen von Blut sichtbar werden (…).
Die Meditation, die Johannes uns anbietet, bevorzugt die mystagogische Dimension, die des Geheimnisses. Etwas wird verstanden, und um es zu verstehen, müssen wir uns anstrengen; aber es ist auch wahr, dass uns vieles entgeht. Der Aufruf Jesu: „Der Geist ist es, der Leben gibt, das Fleisch nützt nichts“ (V. 63a) ruft uns zum Handeln auf. (V. 63a) stellt den Heiligen Geist im eucharistischen Geheimnis in Frage.
Der Geist ist der große Protagonist jedes Kommens von Christus unter uns. Durch sein Wirken nimmt das ewige Wort im jungfräulichen Schoß Marias Gestalt an, und wiederum durch sein Eingreifen werden Brot und Wein verwandelt. Wenn wir uns mehr auf den Geist berufen, werden wir Intelligenz haben, um zu verstehen; Kraft, um zu handeln; Phantasie, um zu erfinden; Stolz, um Schwierigkeiten zu begegnen; Gelassenheit, um die Entmutigung zu vertreiben, die kommt, wenn die erhofften Früchte nicht reifen; vertrauensvolle Hingabe, um der Angst zu entgehen, allein und unfähig zu sein.
Kurz gesagt, es wird der Beginn „unseres Himmels“ sein, sagt die heilige Therese von Lisieux, wie sie zu Beginn dieser Überlegungen sagte.
Jesus hat nicht die Absicht, seine Botschaft zu schmälern oder zu verändern: Er will nicht gegen den Willen des Vaters verstoßen, für den er sein ganzes Leben eingesetzt hat (vgl. Joh 4,34; 5,30) und dessen Offenbarung er ist. Es liegt am Menschen, sich vom Vater und vom Geist bewegen zu lassen, um sich in die Logik des göttlichen Plans einzufügen. Jesus erinnert uns daran mit dem Satz: „Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater erlaubt es ihm“ (V. 65).
An diesem Punkt ziehen sich viele zurück und lassen Jesus im Stich. Nach Ansicht der Gelehrten handelt es sich um die galiläische Krise, da sie sich in Galiläa ereignet: „Von da an kehrten viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm“. (v. 66). Der wörtlich übersetzte griechische Text klingt schärfer: „Viele seiner Jünger wandten sich von ihm ab“.
Ihm nachzufolgen bedeutete, hinter dem Meister zu sein und mit ihm auf den Wegen zu gehen, die er kannte und wählte, auch auf den unebenen. Nun ist dieser Weg unterbrochen, viele wollen nicht bei ihm bleiben, weil sie nicht akzeptieren, auf Wegen zu gehen, die der Verstand nicht versteht oder die das Gedächtnis nicht erkennt.
Die letzte Frage der Juden sanktionierte die Trennung der meisten von Jesus, der Ostern mit einigen wenigen, den Vertrauten, leben wird, die bereit sind, ihm auch dort zu folgen, wo die Vernunft sich instinktiv weigert, zu gehen.
Der zweite Teil des liturgischen Textes ist positiv und beruhigend. Der Abtrünnigkeit der Jünger wird nun die Treue der Zwölf gegenübergestellt (bis auf einen, vgl. V. 70-71, nicht im Text). Diesmal ist es Jesus, der den Zwölfen eine brennende Frage stellt: „Wollt ihr auch weggehen? (v. 67). Die provokante Frage erinnert uns einmal mehr daran, dass ein anderer Weg als der angegebene nicht praktikabel ist. Man kann die Richtung nicht ändern. Man kann aber auch weggehen oder weniger anspruchsvolle Reisebegleiter wählen.
Der Hauptgrund für die Abtrünnigkeit der früheren Gruppe war das Unverständnis der Worte Jesu in Verbindung mit der Vorgabe, das Geheimnis seiner Person zu verstehen. Um Jesus nachzufolgen, will der Mensch verstehen und verschließt sich damit dem transzendenten Handeln Gottes; dadurch isoliert er sich und driftet schließlich ab. Doch fern von ihm ist es nur Nacht, nur Dunkelheit.
Die Antwort des Petrus umgeht das Hindernis, indem sie den ewigen Wert des Wortes Jesu und seinen göttlichen Ursprung in seiner Person anerkennt: „Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens; wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist“ (V. 68-69).
Bravo Peter! Er spürte, dass der Weg der reinen und einfachen Vernunft nicht weit führt. Höchstwahrscheinlich hat auch er die Rede Jesu nicht verstanden und war genauso verwirrt wie die anderen. Aber er geht einen anderen Weg und überlässt sich vertrauensvoll den Worten des Meisters. Es sind Worte, die wie so viele andere, die zuvor gesprochen wurden, eine göttliche Qualität haben, weil sie von einem kommen, der bereits Zeichen der Außergewöhnlichkeit gesetzt hat. Man muss bei ihm sein und seiner Person das größte Vertrauen entgegenbringen. Er hat Worte, scharf wie Klingen, die Orientierung geben und den Menschen zu Gott führen. Wo die Vernunft aufgehört hat, geht der Glaube weiter, der mutige Liebe, bedingungsloses Vertrauen, Anerkennung der eigenen Erkenntnisgrenze und Akzeptanz göttlicher Überraschungen ist.
So überwindet Petrus, der zum Sprecher des apostolischen Kollegiums wird, den Felsen, an dem die Träume der Jünger zerschellten, und setzt den Weg mit Jesus fort. Ihm nachzufolgen wird anspruchsvoller, ja gewagter: Er wird den Tunnel des Leidens und des Todes durchschreiten, aber er wird in der Herrlichkeit der Auferstehung, im Triumph des Lebens, wieder auftauchen.
Erste Lesung: Der Alte Bund: ein Gott „mit“, ein Gott „für“
Im Laufe der bewegten Geschichte der Liebe zwischen Gott und seinem Volk gab es immer wieder den klaren Wunsch, sich auf die Seite Gottes zu stellen: dem Gott, der sich selbst gibt, muss man sich selbst geben. Ein Beispiel dafür findet sich in der ersten Lesung, in der von einer mutigen Entscheidung des Volkes für den Herrn berichtet wird, die von Josua vorangetrieben wurde. Nach einer kurzen geschichtlichen Einführung (V. 1-2) appelliert Josua an das Volk, den Verheißungen Gottes treu und würdig zu bleiben; dann folgt eine prompte und positive Antwort (V. 15-18).
Der Weg des Exodus ist abgeschlossen, und Josua hat das Volk in das verheißene Land geführt. Die geografische Reise ist zu Ende, aber nicht die geistige. Es ist notwendig, die gesamte Geschichte Israels mit seinem Gott zu überdenken und mutige Entscheidungen zu treffen, im Gegensatz zu der einfachen Haltung, selbstgefälligen Gottheiten wie denen in Kanaan zu folgen. Josua bittet darum, Gott zu „dienen“: Das Verb kehrt mit Nachdruck zurück (sechsmal) und drückt die Haltung derer aus, die ihre Existenz in Verbindung mit dem Gott aufbauen, der das Volk dorthin gebracht hat.
Die Hebräer, die aus Ägypten gekommen sind, beginnen nach dem gewaltigen Abenteuer der Überquerung des Roten Meeres ihren Marsch in die Wüste. Die Wüste war die Erfahrung „von Gott und mit Gott“, eine Erfahrung, die manchmal so glücklich ist, dass sie in der Erinnerung bewahrt werden kann, und manchmal so hart, dass sie zu jener Läuterung führt, die nur die Reue hervorbringen kann. Die Wüste, per definitionem ein unwirtlicher Ort, ist auch ein Ort des Wunders, den die Hebräer plötzlich mit Zeichen des Segens erfüllt sehen: Manna, Wachteln, Wasser. Die Wüste gibt einen Vorgeschmack auf die bis dahin unbekannte Dimension der Freiheit. Zum ersten Mal lernt das Volk, sich selbst zu bewegen, selbst zu entscheiden, sich mit seinem Gott zu treffen. Freiheit ist nicht nur ein negatives Konzept: frei zu sein von jemandem oder etwas. Man kann für jemanden oder etwas frei sein. Israel wird befreit, um bei seinem Gott zu sein, um ihm zu „dienen“, was dem Leben eine liturgische Note verleiht. Manchmal ist das Ergebnis glücklich, ein anderes Mal ist man das Opfer sehnsüchtigen Bedauerns. Die Juden müssen bald feststellen, wie ernst ihre Unerfahrenheit mit der Freiheit ist. Es reicht nicht aus, ein für alle Mal formell für frei erklärt zu werden: Freiheit ist eine schwierige Verpflichtung, eine schwere Verantwortung, die durch eine Reihe von Erfahrungen erlernt wird, bei denen die Wüste eine entscheidende pädagogische Funktion hat. Der lange Aufenthalt wird eine Strafe sein, aber auch eine Vorsehung, denn er wird die Menschen schrittweise auf den Geschmack der Freiheit bringen. Tag für Tag lernt das Volk das wunderbare Geheimnis der göttlichen Fruchtbarkeit kennen und leben, das Wunder hervorbringt, allen voran das Wunder der Liebe.
Das Volk antwortete auf die göttliche Liebe mit einer erneuten Verpflichtung zur Einhaltung des Bundes: „Es sei fern von uns, den Herrn zu verlassen und anderen Göttern zu dienen! Denn der Herr, unser Gott, hat uns und unsere Väter ausgesandt […]. So lasst uns auch dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott“ (V. 16-18). Die Wahl ist klar und deutlich. Man muss ihm treu sein, um sein Dasein in einen Dienst an Gott zu verwandeln, d.h. in eine Liturgie des Lobes, wie es der Antwortpsalm nahelegt.
Die Entscheidung für Gott und die Antwort auf ihn kann als „Dienst“ bezeichnet werden. Der Mensch erweist Gott seinen Dienst, wenn er sein Dasein als Lob und Dank einrichtet, wie es in der ersten Strophe heißt: „Ich will den Herrn loben allezeit, auf meinen Lippen stets sein Lob“. Die Worte zeigen, wie wichtig Gott im Leben des Psalmisten ist: Er steht an erster Stelle. Der Vorrang Gottes im Leben des Menschen: Das ist der grundlegende Weg, Gott zu dienen.
Die anderen Verse bringen die Überzeugung von der Nähe Gottes auch in schwierigen und verhängnisvollen Situationen zum Ausdruck: „Der Gerechte hat viele Übel, aber der Herr befreit ihn von ihnen allen“.
Der „Gerechte“, d.h. der mit Gott im Einklang stehende Mensch, erweist ihm einen Dienst, wenn er die Ereignisse als vom Vater gesteuert, gewollt oder „erlaubt“ liest: nichts entgeht seinem Blick, nichts wird seiner wohlwollenden und barmherzigen Liebe entzogen. Der biblische Mensch – und heute der Christ – erkennt nicht nur die Existenz Gottes an, sondern ist zutiefst davon überzeugt, dass Gott für ihn und für die ganze Welt da ist. Er ist ein Gott „mit“ und ein Gott „für“.
Eine solche Überzeugung ist Teil des „Dienstes“ an Gott, d.h. der wohlwollenden Beziehung, die der Mensch in Gang setzt, wenn Gott sich liebevoll vor ihm verneigt hat.
Zweite Lesung: Bräutlicher Bund
Das Konzept der gegenseitigen Hingabe, das bereits in den beiden vorangegangenen Lesungen zu sehen war, wird in der zweiten Lesung mit der Kategorie der Ehegatten erneut vorgeschlagen. Der Gedanke eines Bundes wird durch den Verweis auf die Ehe zwischen Mann und Frau begünstigt, die auf die parallele Verbindung zwischen Christus und der Kirche verweist.
Der Text gehört zur literarischen Gattung des „Familienkodex“, einem Syntagma, das sich zur Bestimmung eines Beziehungsnetzes innerhalb der Familie eingebürgert hat. Die hellenistische Moralphilosophie fasste die Pflichten des Menschen gegenüber der Familie und der Gesellschaft gerne in knappen Sätzen zusammen (vgl. Epiktet). Die christliche Welt greift diesen Brauch auf (vgl. auch Kol 3,18-4,1; 1 Tim 2,8-15; Tit 2,1-10; 1 Petr 2,13-3,7) und verleiht ihm vor allem dank seiner starken und präzisen theologischen Anziehungskraft eine originelle Konnotation. Auch wörtlich und inhaltlich wird eine Neuerung eingeprägt, die als Gegenseitigkeit vorgeschlagen wird: Alle sind Subjekte von Rechten und Pflichten. Der Brief an die Epheser ist am innovativsten, weil er sich ausführlich mit der Beziehung zwischen Mann und Frau befasst und diese Beziehung als Spiegel und Abbild der Beziehung zwischen Christus und der Kirche liest. Es handelt sich also nicht nur um eine „Verchristlichung neutraler ethischer Inhalte“ (Ernst), sondern vielmehr um eine Darstellung des soteriologischen Geheimnisses in bräutlicher Form. Das Ergebnis ist eine Theologie, die in den natürlichen Daten verankert ist, aus denen sie ihre Inspiration bezieht und denen sie den höchsten Ausdruck verleiht.
Die Ermahnung richtet sich zunächst an die Ehefrauen (V. 22), dann an die Ehemänner (V. 25a), aber der Hauptbezug ist auf Christus und seine Gemeinde gerichtet (V. 23; V. 25b und folgende). Der Anfang von V. 21 ist eine Aufforderung an alle, im Gegensatz zu V. 22, in dem es heißt: „Die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen“. Eine solche Forderung stört und schockiert sogar den modernen Leser. In einer Zeit sozialer und zivilgesellschaftlicher Errungenschaften, in der die Gleichberechtigung der Frau so viele Kämpfe ausgelöst hat, klingt Unterwerfung sogar verwerflich.
Es lohnt sich, den Wert des am stärksten belasteten Verbs zu untersuchen, das zu Unrecht durch eine falsche Interpretation benachteiligt wird: „unterwürfig sein“. Das Verb ypotasso im weltlichen Griechisch gehört zur Militärsprache und bezeichnet die Unterordnung des Untergebenen unter den Oberen. Im neutestamentlichen Griechisch ist die Bedeutung spezialisiert. Manchmal deutet es auf die willenlose Unterwerfung der Dämonen hin, die gehorchen müssen (vgl. Lk 10,17); ein anderes Mal, wenn der Satz Gott zum Subjekt hat und das Verb aktiv verwendet wird, bezieht sich die Bedeutung auf die souveräne Herrschaft über die Welt: Die Unterwerfung ist also das Ergebnis der geschaffenen Ordnung (vgl. 1 Kor 15,27; Eph 1,22). In anderen Fällen, vor allem wenn das Verb in der passiven Mittelform verwendet wird, wird die Bedeutung positiv und macht die Unterwerfung freiwillig und voller Liebe. Dies zeigt sich daran, dass Jesus seinen Eltern gegenüber respektvoll ist (vgl. Lk. 2,51); dass die Christen einander unterwürfig sind (vgl. 1 Kor 16,16) und dass selbst Jesus dem Vater gehorsam ist (vgl. 1 Kor 15,28). Selbst im Falle der Unterwerfung unter die zivile Autorität (vgl. Röm. 13,1.5) deutet die Verwendung des Verbs auf ein Bewusstsein hin, das sich aus der freien Unterwerfung ergibt. Also kein Zwang und schon gar keine Sklaverei. Außerdem wurde der Leser von V. 22 bereits durch V. 21 vorbereitet, wo es heißt: „Unterwerft euch einander in der Furcht Christi“: Der Gedanke der Unterwerfung betraf alle und war in der Liebe („Furcht“) Christi verwurzelt.
Der Verfasser des Epheserbriefes ist besonders großzügig mit theologischen Anmerkungen, denn im Vergleich zu den dürftigen Anforderungen der analogen Stelle in Kol 3,18 rechtfertigt er die Unterordnung der Ehefrauen ausführlich mit dem Hinweis auf die Beziehung zwischen Christus und der Kirche. Das Ergebnis ist eine Pendelbewegung, die zwischen der familiären Situation und dem Idealmodell schwankt. So wird bei näherer Betrachtung, jenseits der instinktiven und emotionsgeladenen Reaktionen, die pyramidale Struktur der alten Familie durch die neue Darstellung fruchtbar aufgebrochen. Der Verfasser des Briefes stellt das Modell der wahren Liebe vor, das jede Beziehung bestimmen muss. Die sich daraus ergebende Struktur ist nicht nur versöhnlicher, sondern auch persönlicher und selbst für die bereitwillige kritische Reaktion des modernen Menschen voll akzeptabel.
Nach der Feststellung, dass der Ehemann nach dem herkömmlichen hierarchischen Prinzip das Haupt ist (vgl. V. 23), wird sogar dieses ungeliebte Konzept zugunsten einer akzeptableren Auslegung relativiert. Einmal mehr wird der Bezug auf Christus, der den wahren Titel des Hauptes trägt, als Retter seiner Kirche entscheidend. Die Autorität Christi wird in der Hingabe seiner selbst ausgeübt, die bis zum Tod reicht. Die Kirche wird als „sein Leib“ definiert, und das Haupt ist ohne Bezug auf den Leib nicht denkbar. Dieser Gedanke begründet die enge Verbindung zwischen Christus und der Kirche, eine entfernte Vorbereitung auf das unum, auf das in V. 31 Bezug genommen wird. Der Gedanke der Einheit wird durch den der Erlösung verstärkt und bereichert: Christus, der mit seiner Kirche vereint, aber auch von ihr getrennt ist, hat sich ihr ganz hingegeben. Christus ist das Haupt, das für den ganzen Leib sorgt und ihn am Leben erhält, vgl. 4,15-16. Die Aufforderung an die Ehefrauen, sich zu unterwerfen (vgl. V. 24), ist nur analog von dem oben vorgeschlagenen Modell inspiriert; sie bleibt jedoch eine Aufforderung, mit Liebe auf die Liebe zu antworten.
Und von der Liebe der Ehemänner ist in Vers 25 die Rede. Sie werden aufgefordert, ihre Frauen zu lieben, „wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat“. (v. 25). Die Verwendung des Verbs agapao ist bereits ein erster wertvoller Hinweis darauf, um welche Art von Liebe es sich handelt: Es ist die Liebe des Geschenks, im Gegensatz zur Liebe der Aneignung, die gleichbedeutend ist mit der Ausbeutung, die dem Eros eigen ist. Der wichtigste Teil des Verses liegt in dem Vergleich „wie Christus die Kirche geliebt hat“ und mehr noch in dem Satz, der folgt „und sich für sie hingegeben hat“.
Die Bedeutung ist folgende: Christus hat die Kirche geliebt, weil er sich für sie hingegeben hat, oder er hat sie geliebt, weil er sich für sie hingegeben hat. Das „für sie“ weist nicht nur auf die Befreiung von der Sünde oder von der Welt hin, wie es bei Paulus im Allgemeinen der Fall ist (vgl. 1 Kor 15,3; 11,24; Gal 1,4), sondern es weist vielmehr auf einen Akt der Liebe hin, und zwar den Akt der Liebe schlechthin, den Prototyp jedes Aktes der Liebe. In einem Abschnitt aus dem Johannesevangelium drückt Jesus dies ausdrücklich aus: „Niemand hat eine größere Liebe als die, dass er sein Leben für seine Freunde hingibt“ (Joh 15,13). Definitorisch könnte man sagen, dass die Kirche aus dem Kreuz geboren ist (vgl. 2,16).
Die Neuheit kommt nicht aus dem Staunen heraus, denn nun wird eine Interpretation des Heilstodes Christi angeboten, die im gesamten NT keine Entsprechung hat. Dieser Zweck wird in zwei Schlusssätzen dargestellt, einer in V. 26 und der andere in V. 27. Die Auswirkungen der Taufe werden positiv als „Heiligung“ und negativ als „Reinigung“ bezeichnet. Die Taufe wird nicht mehr im Kontext der Waschungen (wie in Qumran) interpretiert, sondern in der Perspektive des rettenden Todes Christi. Die Heiligung, die sich daraus ergibt, ist also sakramentaler Art; sie ist in der Tat eine Weihe, eine Erhebung in die Sphäre Gottes. Die Taufe erfolgt durch das Ausgießen von Wasser (Waschung) und durch das Wort. Dieses Wort, das vielleicht noch keine kodifizierte Taufformel ist, bezeichnet höchstwahrscheinlich die Anrufung des Namens Jesu (vgl. Apg 2,38; 1 Kor 6,11).
Nach dem ekklesiologischen Exkurs kehrt der Diskurs auf die mahnende Schiene zurück und wiederholt die Pflicht der Ehemänner, ihre Frauen zu lieben (vgl. V. 28). Um die Pendelbewegung fortzusetzen, kehren wir zum Modell der Christuskirche zurück, und der Vergleich gipfelt in V. 31-32, wo das Zitat von Gen 2,24 entscheidend ist. An dieser Stelle scheint das Modell der Christuskirche, an dem sich das Modell der Eheleute orientieren sollte, zugunsten des ehelichen Datums umgedreht zu werden, das als Bezugsrahmen für das „große Geheimnis“ (vgl. V. 32) der Christuskirche gilt: „Es ist daher schwierig zu bestimmen, welche der beiden Komponenten des Diskurses die Kette und welche der Schuß ist“ (Penna).
Gebet
Nachdem wir uns mit diesen geistlichen Liedern geheiligt haben, bitten wir den barmherzigen Gott, den Heiligen Geist auf die Opfergaben zu senden (die auf den Altar sind), damit er das Brot zum Leib Christi und den Wein zum Blut Christi mache. Denn was der Heilige Geist berührt, wird vollkommen geheiligt und verwandelt. AMEN. (Hl. Kyrill von Jerusalem)
Mauro Orsatti, Emeritierter Professor für Exegese des Neuen Testaments an der Theologischen Fakultät in Lugano (In: Servitori della Parola: Commento alle letture festive dell’anno B, Queriniana, Brescia 2011, 246-251.)